
Mit seinen geometrischen Formen wirkt das Konzerthaus wie ein gelandetes Raumschiff. (Foto: Adam Mørk)
Wie ein gelandetes Raumschiff sitzt das Gebäude inmitten einer grünen Anlage der Stadt am Ostseestrand. Eine imposante Plaza breitet sich vor dem fast 7.000 Quadratmeter fassenden Gebilde aus schrägen Kanten und Glasflächen aus. Das im Juli 2019 eröffnete Konzerthaus „Latvija“ mit angeschlossener Musikschule und Musikbibliothek im lettischen Ventspils ist ein Augenschmaus — nicht nur von außen.
Wer über die Schwelle des rund 31 Millionen Euro teuren Konzerthauses schreitet und seinen Weg in den größeren der beiden Konzertsäle — der große fasst rund 600, der kleine rund 150 Menschen – findet, kommt ins Staunen: Hoch über den Köpfen schweben Lampen, die an Mantarochen erinnern, elegante Holzrippen fassen den Blick auf die Bühne ein. Das Konzerthaus beherbergt die einzige Musikbibliothek Lettlands, eine einzigartige Akustikorgel des deutschen Orgelbauers Johannes Klais und das wahrscheinlich größte Klavier der Welt. 800 Kilogramm schwer mit bis zu fünf Meter langen Saiten, hängt es vertikal drei Meter über dem Boden an der Wand und ist nur über eine Treppe zugänglich.
Bibliothek, Schule und Studio für Musik
Wer nach einer Vorstellung im Konzertsaal neugierig auf neue Musik geworden ist, sollte nebenan in der Musikbibliothek vorbeischauen. Auf über 150 Quadratmetern bietet sie nicht nur Schülern der Musikschule Erbauung, sondern ist auch der Öffentlichkeit zugänglich. Unter anderem beherbergt sie einen akustisch dichten Raum inklusive Bildschirm für ganz besondere Musikerlebnisse sowie ein Tonstudio für Aufnahmen.
„Kein Tag ist wie der andere“
Dieses musikalische Wunderland ist der Arbeitsplatz von Edgars Šifers. Er fing nach der Fertigstellung der Konzerthalle im August als technischer Leiter dort an. Davor hatte er zwölf Jahre lang als Systemadministrator in der IT-Branche gearbeitet. Er mag seine neue Stelle, denn: „Kein Tag ist wie der andere. Weil das Gebäude neu ist, sind wir noch dabei, es verstehen zu lernen.“ Als IT-Spezialist arbeitet er mit dem Gebäudemanagement-System und ist für Elektrizität, Überwachungstechnik, Brandschutz und die Lüftung verantwortlich. Gerade Letztere nimmt ihn in dieser Anfangsphase noch ordentlich in Beschlag. „Bei der Konfiguration der Lüftung lerne ich fast täglich etwas Neues“, sagt er.

Facility-Manager Šifers konfiguriert die Klimatisierung. (Foto: Lauris Aizupietis)
Mehrere Systeme leisten die Lüftung und Klimatisierung des Konzerthauses. Insgesamt gibt es neun zentrale Lüftungssysteme und ein dezentrales System, das mit Einzelgeräten arbeitet. Während die beiden Konzertsäle zentral versorgt werden, bringt in den kleineren Übungsräumen und der Musikbibliothek dezentrale Fassadenbelüftung Frischluft ins Spiel – und das auf eine innovative Art und Weise.
Dezentrale Lüftung „atmet“
Insgesamt 74 Geräte der Stuttgarter Firma LTG AG namens FVPpulse arbeiten in den Räumen im Boden sowie an der Fassade und „atmen“. In den Einheiten ist jeweils ein Ventilator verbaut und ein Motor steuert eine Klappe, die alle 20 Sekunden ihre Stellung wechselt und so Zustrom und Abluft regelt — das Ein- und Ausatmen, sozusagen. Frischluft und Abluft werden über ein und dieselbe Öffnung in der Wand eingesogen und ausgeblasen.
Hier sind keine Lüftungskanäle notwendig und der Installationsaufwand verringert sich deutlich. Die Geräte arbeiten automatisch und regeln zudem das CO2-Niveau der Luft in den Übungsräumen.
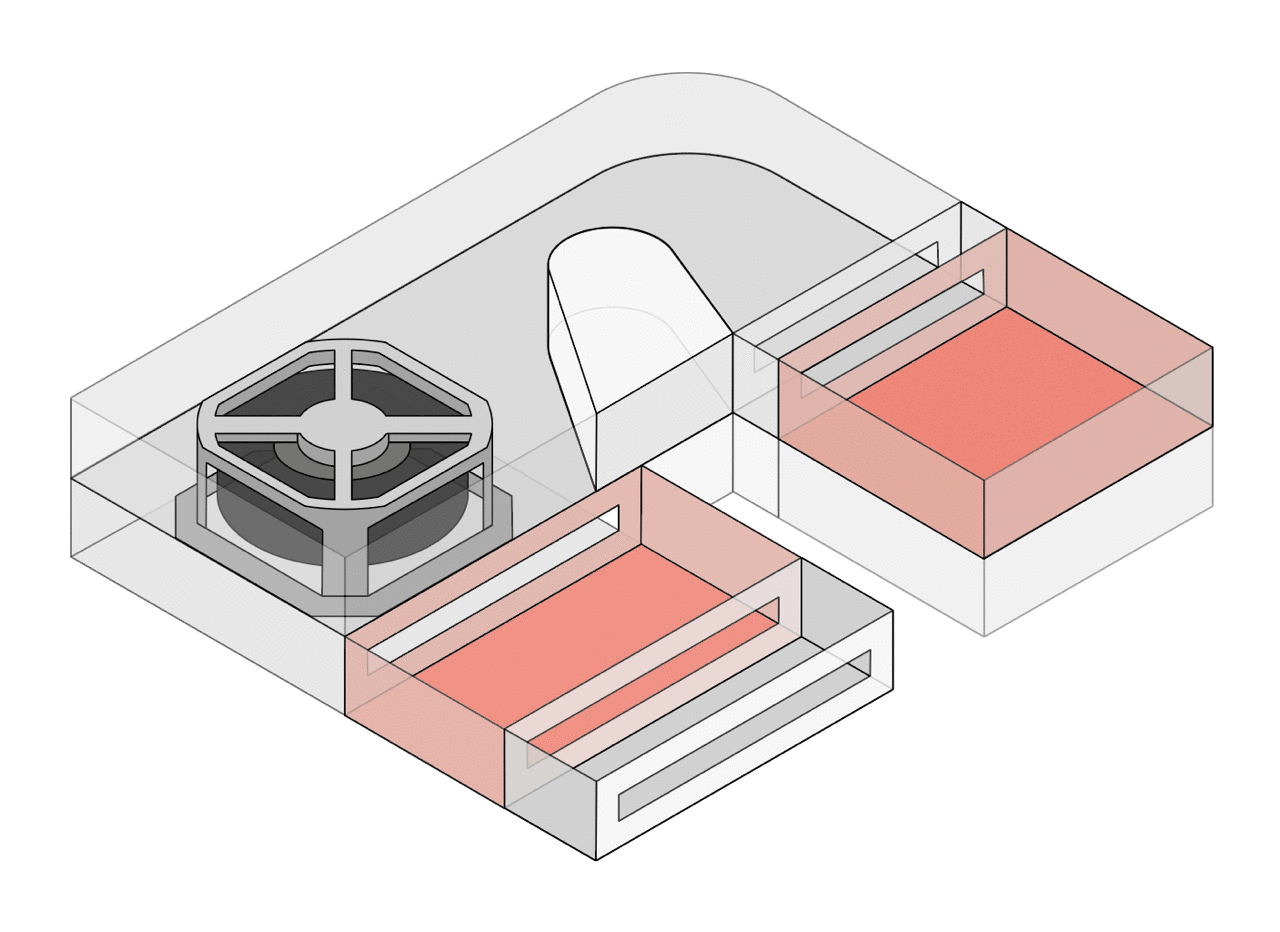
Obendrein tragen sie ihren Teil zum Grundgedanken bei, ein energieeffizientes Gebäude zu schaffen. „In einem Raum mit drei Personen fahren wir mit unter zehn Watt Leistungsaufnahme. Das ist schon ein großer Wurf“, sagt LTG-Vorstand Ralf Wagner. Auch bei der Wärmerückgewinnung, bei der mittels eines Wärmespeichers die von außen angesaugte Luft im Gerät erwärmt wird, haben die LTG-Ingenieure ganze Arbeit geleistet: „Wir erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent.“ Zusätzliche Maßnahmen zur Energieeffizienz sind eine Wärmepumpe mit rund 400 Erdsonden und fünf je etwa 100 Meter lange Lüftungskanäle unter dem Konzerthaus.

Für Besucher der Musikbibliothek und Schüler der Musikschule sind ein optimales Raumklima und eine leise Lüftung unerlässlich. Das besorgen im Boden verbaute, dezentrale Lüftungsgeräte. (Foto: Lauris Aizupietis)
Lüftung muss leise sein
Neben Fragen der Effizienz waren in puncto Lüftung aber vor allem akustische Werte wichtig. In den Räumen der Musikschule, in denen Einzelunterricht stattfindet, wäre ein lautes Lüftungsgerät schließlich extrem störend. „Beim FVPpulse gab es strikte Vorgaben an die Geräuschentwicklung. Das hat uns zusammen beschäftigt“, sagt Rudi Weinmann, der als regionaler Vertriebsleiter bei ebm-papst schon seit mehr als 20 Jahren den Kunden LTG betreut. In den FVPpulse-Geräten arbeitet jeweils ein rückwärtsgekrümmter Radialventilator RadiCal von ebm-papst, der an sich schon sehr leise ist. Allerdings ergaben sich durch die asymmetrische Ansaugsituation und die Klappenbauweise der Geräte Verwirbelungen in der Zuströmung zum Ventilator und dadurch zu hohe Geräuschemissionen.

Edgars Šifers mag seinen Job: „Kein Tag ist wie der andere“, sagt er. (Foto: Lauris Aizupietis)
„Es entstanden Wirbelzöpfe, die unmittelbar auf die rotierenden Laufradschaufeln trafen und so einen störenden Drehklang erzeugten“, erzählt Weinmann. Zusammen kam man auf die Lösung des Problems: das Vorleitgitter FlowGrid von ebm-papst. An der Ansaugseite angebracht, spaltet es die Wirbelzöpfe auf und schwächt sie beim Durchfluss deutlich ab. Dadurch konnte der Schalldruckpegel reduziert und die Geräuschemissionen schließlich um sechs dB(A) gesenkt werden.
Es gibt noch Verbesserungspotenzial
Die Lüftung arbeitet also leise und effizient — doch es geht immer noch besser. Das denkt zumindest Edgars Šifers. Er experimentiert derzeit mit der Steuerung der FVPpulse-Geräte, die Basis bilden die Arbeitszeiten der Musikschule. Deren Betrieb beginnt um acht Uhr und endet um 21 Uhr. Um Energie zu sparen, bleiben die Lüftungsgeräte außerhalb dieser Zeit ausgeschaltet. „Wenn die Geräte aber erst um acht Uhr aktiviert werden, ist das nicht optimal fürs Raumklima“, sagt er. „Wir werden sie jetzt erst einmal bereits um sechs Uhr anschalten und schauen, wie das läuft. Vielleicht reicht es dann in Zukunft, wenn sie erst ab sieben Uhr laufen.“ Wie in den kleinen Klassenzimmern, wo Tonleitern und Rhythmen geübt werden, braucht es also auch beim Einstellen der Lüftung etwas Geduld.




Schreiben Sie einen Kommentar